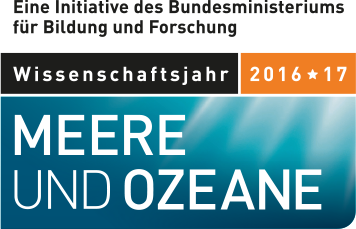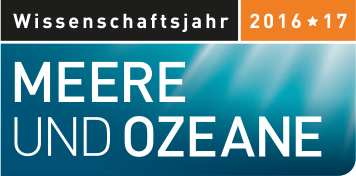Das Blaue Telefon: Ihre Fragen zum Thema Meere und Ozeane

Es ist, bildlich gesprochen, so blau wie der Ozean weit draußen auf hoher See: das Blaue Telefon. In der gleichnamigen Rubrik beantwortet die Zeitschrift mare, Medienpartner des Wissenschaftsjahres 2016*17, in Zusammenarbeit mit MARUM, dem Bremer Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, in jeder Ausgabe Fragen ihrer Leser.
Wenn auch Sie eine Frage ans Blaue Telefon haben, schreiben Sie eine E-Mail an wat(at)mare.de.
Haben Pinguine Probleme mit kalten Füßen?
Kalte Füße? Wer kennt das nicht? Pinguine, die sich in eisigen antarktischen Gefilden wohl fühlen, haben sogar extrem kalte Füße. Doch sie können gar nicht anders, denn warme Füße könnten ihnen zum Verhängnis werden. Sie würden das Eis bzw. den Schnee schmelzen.
Die flugunfähigen Vögel könnten dann festfrieren. Zudem wäre der Wärmeverlust enorm. Das aber verhindert ein geniales Wärmetauscher-Prinzip: Statt durch einige große Adern fließt das warme Pinguinblut durch viele kleine Äderchen in die Füße. Diese sind quasi auf Tuchfühlung mit jenen Venen, die das kalte Blut aus den Füßen wieder Richtung Körperzentrum zurücktransportieren. Der Effekt: Auf dem Weg in die Füße gibt das warme Blut seine Energie direkt an das kalte, Richtung Körperzentrum fließende Blut ab. Besondere Proteine und Fettpolster in den Füßen sorgen im Übrigen dafür, dass diese trotz geringer Temperatur ihren Job erfüllen können. Um Wärmeverluste zu vermeiden, minimieren Pinguine zudem die Kontaktfläche zum Eis: Wenn sie in Gruppen beieinanderstehen, balancieren sie zumeist auf ihren Hacken.
Gibt es eigentlich auch ein Südlicht?
Nordlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes auf Gasteilchen in der Atmosphäre treffen und sie zum Leuchten anregen. Der Sonnenwind, der mit 400 bis 800 Kilometern pro Sekunde durch den Weltraum fegt, wird vom Erdmagnetfeld abgebremst und teils um die Erde herumgeleitet, teils zu den Polen hin abgelenkt. Dies geschieht sowohl auf der Nordhalbkugel als auch auf der Südhalbkugel. Es existiert also auch ein Südlicht, die aurora australis, im Gegensatz zum Nordlicht, der aurora borealis.
Der Begriff Polarlichter bezeichnet also die Lichterscheinungen an beiden Polen. Umgangssprachlich hat sich indes das Wort Nordlicht durchgesetzt, was auch daran liegen dürfte, dass aufgrund der ungleichen Verteilung von Kontinenten und Ozeanen Nordlichter gegenüber Südlichtern für sehr viel mehr Menschen erlebbar sind. Zu den wenigen Glücklichen, die das Privileg genießen, Südlichter beobachten zu können, gehören die Mitarbeiter des Alfred-Wegener-Instituts (AWI), die in der antarktischen Neumayer-Station überwintern. So schreibt ein Überwinterer: "Es hatte etwas unwirkliches und außerirdisches dort mitten in der Eiswüste zu stehen und Zeuge dieser fabelhaften Lichtershow zu sein."
Gibt es Inuit, die ständig auf Eisschollen leben?
„Nein“, sagt die Ethnologin Gudrun Bucher, Mitautorin an einem umfassenden Handbuch über die indigenen Völker Nordamerikas. „Inuit bewegen sich über das Eis und jagen auf ihm, aber sie leben nicht darauf – dazu ist es zu wandelbar und zu beweglich. Das haben aus der Not heraus nur Schiffbrüchige, meist Polarforscher getan.“ Interessanterweise erzählen die Sagen der Inuit eine andere Geschichte. Bei den Tschuktschen, die am östlichsten Zipfel Russlands leben, verwandelt sich ein Polarjäger, der auf einer Eisscholle abtreibt in ein Teryky, ein fellbewachsenes Ungeheuer. Kehrt es an Land zurück, muss es getötet werden.
Davon schreibt der tschuktschische Autor Juri Richtëu eindringlich in seinem Roman „Teryky“. Wären die Tschuktchen den berühmtesten „Eisschollenbewohnern“, dem Antarktisforscher Sir Ernest Shakleton und seiner Mannschaft begegnet, so wäre es kein Wunder gewesen, wenn sie sie für Teryky gehalten hätten. Die 28 Mann überlebten nach dem Untergang ihres Expeditionsschiffs Endurance am 27. Oktober 1915 fast sechs Monate auf dem Packeis der Antarktis. Insgesamt dauerte ihr Martyrium fast zwei Jahre. Das danach niemand gut rasiert und wohlduftend an Land kommt, sondern eher in der Manier der Teryky, ist nur allzu verständlich.
Warum gibt es an der Nordsee keinen Stockfisch?
Fisch und Besuch stinken nach drei Tagen, sagt der Volksmund. Zumindest für Fisch muss das nicht gelten. Bevor Kühlschrank und Konservendose ihren Siegeszug antraten, garantierten Fisch, Fleisch und Obst in getrockneter Form den Menschen gehaltvolle Nahrung zu jeder Jahreszeit. Beim Trocknen gehen über zwei Drittel jener Flüssigkeit verloren, in der Fäulnisbakterien sich vermehren. Daher halten sich getrocknete Lebensmittel viel länger.
Stockfisch – so die genaue Bezeichnung für getrockneten, aber ungesalzenen Fisch – wird meist aus Kabeljau hergestellt. In Island, Norwegen und auf den Färöer-Inseln wird dieser Fisch in großen Mengen gefangen und gleich nach der Anlandung verarbeitet. Die vor der deutschen Küste gefangenen Speisefische sind fettreicher und eignen sich eher zum Räuchern. Doch auch die Tradition spielt bei der Verbreitung von Stockfisch eine große Rolle: Bereits im Mittelalter verproviantierten sich norwegische und isländische Seefahrer für ihre langen Törns mit Stockfisch.
Warum schmecken Salzwassertiere nicht salzig?
Alle Organismen kontrollieren, wie viel Salz sie aufnehmen. Salz ist zwar lebensnotwendig, aber auch hier gilt: die Menge macht's – zu viel oder zu wenig ist tödlich. Obwohl die Meeresorganismen in Salzwasser leben, schmecken sie nicht so salzig, wie man meinen sollte. Blut und Lymphe der meisten Krebse, Muscheln und Würmer enthalten genauso viel Salz wie das Meerwasser, also etwa 35 Gramm pro Kilo. Fischblut enthält nur etwa neun Gramm Salz pro Kilo, denn Fische pumpen über spezielle Zellen in den Kiemen ständig Salz aus ihrem Körper.
Generell gilt, dass das Fleisch der Meerestiere nicht so salzig wie ihre Körperflüssigkeiten. Krebs- und Muschelfleisch weist nur drei bis sieben Gramm pro Kilo auf; Fischfleisch ist mit einem bis drei Gramm pro Kilo sogar weniger salzig als Rind- oder Schweinefleisch. Das Konzentrationsgefälle zwischen den Körperzellen, also dem Fleisch, und den sie umgebenden Flüssigkeiten, also Blut und Lymphe, ist für die biochemischen Abläufe im Körper wichtig. Um es aufrecht zu erhalten, schleusen die Zellen ständig Salze nach außen. Darüber, wie salzig Meeresgetier im Endeffekt schmeckt, wird also eher in der Küche entschieden. Hier kommt es ganz auf die Art der Zubereitung und auf den Geschmack an.